In der wissenschaftlichen Ägyptologie von heute
unterscheidet man -- auf den Erkenntnissen Champollions fußend - fünf Hieroglyphen
Klassen:
1. Alphabetische Zeichen, die einen einzigen Laut repräsentieren.
2. Silbenzeichen, die eine Kombination aus 2 Konsonaten repräsentieren.
3. Silbenzeichen, die eine Kombination aus 3 Konsonaten repräsentieren.
4. Bildzeichen (Ideogramme), die Dinge repräsentieren , die sie abbilden.
5. Determinative. (Bildzeichen, die nicht gesprochen werden, weil sie nur- verdeutlichen sollen, welches Homonym einer voraufgegangen Konsonan-
- tengruppe gemeint ist. Beispiel: das deutsche Wort »Tor«
kann »Dumm-
- kopf« oder »Eingang« bedeuten. Ein Ägypter würde
hinter das Wort »Tor«
- entweder ein Zeichen für »Mensch« setzen, wenn der
»Tor« gemeint ist,
- oder ein Zeichen für »Gebäude«, wo das
»Tor«.)
Geschrieben wurden die Hieroglyphen in Zeilen oder
Kolumnen. Möglich- warern auch beide Leserichtungen, die von links nach rechts, wie die
von
- rechts nach links - wobei die Leserichtung auch vom Laien sofort erkannt
- werden kann, da die Köpfe von Mensch- und Tier-Hieroglyphen jeweils
in
- die Richtung des Textanfangs blicken (siehe unten).
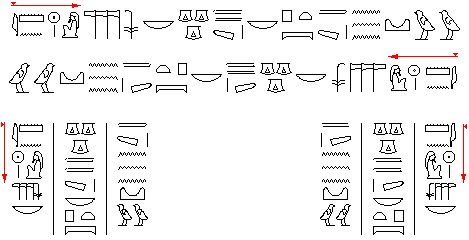
Derselbe Hieroglyphen-Text einmal in Zeilen, dann in Kolumnen,
von rechts und von - links. Wobei die roten Pfeile die jeweilige Leserichtung
angeben. Der Text lautet:
»Amun-Re, König der Götter; Herr
der Throne der beiden Länder; Herr des Himmels,
- der Erde, des Wassers und der Berge.«
Welche Möglichkeitt Schreiber wählten, hing
vom Ort ab, wo eine Inschrift- plaziert werden sollte. Generell läßt sich sagen, daß
die Leserichtung von
- Gebäude-Inschriften immer auf deren Eingang ausgerichtet war,
sodaß die
- Köpfe der Mensch- und Tier-Hieroglyphen den Leser auf dem Gang
durchs
- Innere des Gebäudes immer direkt anschauten.
In Reliefszenen gaben die Hieroglyphen häufig wieder, was die handelnden- Personen sagten. Damit leicht zu erkennen war, wer was sagte, waren
die
- Äußerungen einer Person jeweils in der Richtung geschrieben,
in die sie in
- der Szene agierte.
Die Zeichenfolge in Kolumnen war die gewöhnlichere. Innerhalb von
Kolum-- nen zu lesen war stets von oben nach unten. Hieroglyphen in Zeilen
wurden
- immer dort geschrieben, wo es der Kontext nahelegte, wie über
Türstürzen
- und Toren, auf Sockeln lagernder Tiere, als Band auf Längsseiten
von Sär-
- gen etc. Oder als optischer Kontrast zu Kolumen auf Stelen.
Ästhetischen Kriterien spielten überhapt eine große Rolle.
Sowohl im Gro-- ßen, bei der Plazierung von Schrift als Element einer Gesamtkomposition
aus
- Bildszene und zugehörigem Kommentar, wie im Kleinen, bei der Ausführung
- einzelner Hieroglyphen. So plazierte man Hieroglyphenkombinationen
gern
- so, daß sie ein Minimum an Platz einnahmen. Statt die Zeichenfolge
»t-w-t«
- einfach horizontal nebeneinanderzusetzen
 schrieb man sie lieber
schrieb man sie lieber
- verschränkt
 .
.
Damit erreichte man nicht bloß eine optimale Platzausnutzung, sondern
zu-- gleich ein homogeneres, von optischen »Löchern« freies
Schriftbild, wie es
- bis heute als Merkmal eines »schönen« Layouts gilt.
Schließlich spielten auch noch religiös-magische Kriterien eine
Rolle bei der- Ausführung von Hieroglyphen und Texten. Erfurcht vor den Göttern
und dem
- Pharao verlangte beispielsweise, daß deren Namen immer am Anfang
eines
- Satzes standen, auch wenn dadurch die gesamte Syntax des Satzes durch-
- einandergeriet.
Aber das war nicht weiter tragisch, denn gelesen wurde ohnehin sehr lang-- sam. Hieroglyphen mußten und wurden weniger gelesen als einzeln
ent-
- ziffert - und zwar laut gesprochen. Weil es keine Abstände zwischen
Worten
- und Sätzen gab, stellte sich nämlich erst beim lauten Lesen
eindeutig her-
- aus, wo Worte endete und in welche Sinneinheiten ein Text gegliedert
war.
Zu bedenken ist noch, daß die Hieroglyphen als »Worte der Götter«,
wie- sie sagten, in den Augen der alten Ägypter magische Kraft besassen.
Da-
- mit die von Zeichen, die bedrohliche Wesen darstellten, nicht entfaltet
wer-
- den konnte, schrieb man sie gern verstümmelt wie im folgenden
Beispiel.
-

Die vorderen drei Zeichen geben den Namen der Unterweltsschlange- Apophis wieder, einem der bedrohlichsten Wesen der alt-ägyptischen
Re-
- ligion. Um deren unheilvolle Ausstrahlung zu neutralisieren, sind in
den
- nachgestellten Schlangenkörper (das Determinativ zum Namen) große
- Messer gerammt, die ihn verletzen und zerstückeln sollen.
Wer Hieroglyphenschrift und alt-ägyptischer Sprache
ausführlicher als- hier kennen lernen will, dem bietet das Internet eine Reihe brauchbarer
- Ressourcen. Einige der besuchenswerteren haben wir auf der nächsten
- Seite zum Ansurfen zusammengestellt.
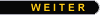
- .







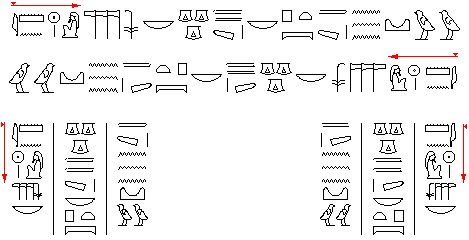
 schrieb man sie lieber
schrieb man sie lieber .
. 